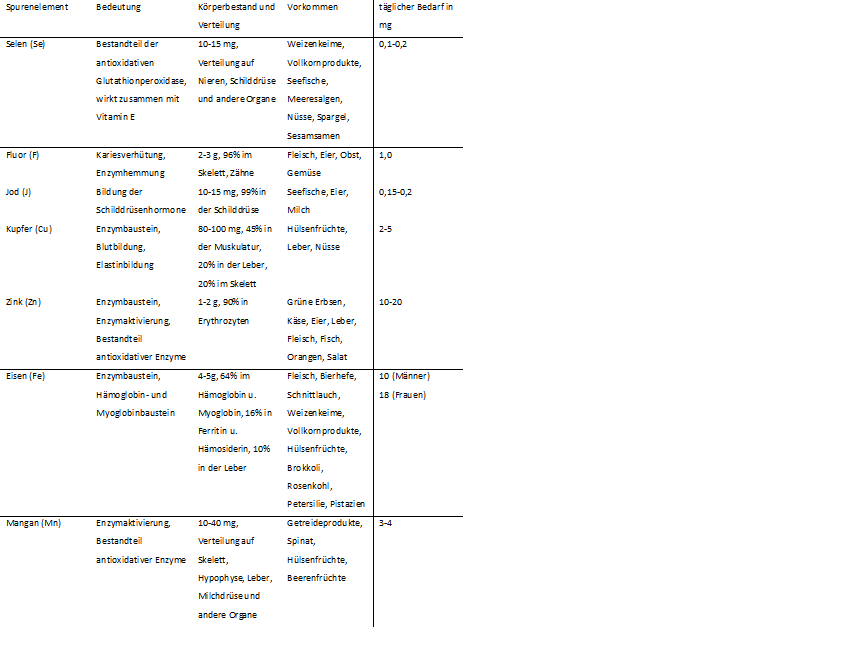Es ist Dienstag, der 06. März 2018, 10:30 Uhr. Vor der Hausnummer 40 im Safari Village in Saly tummeln sich ein paar Weißhäuter, um sich zu verabschieden. Wir sagen „auf Wiedersehen“ zu unserer lieben Magret und ihren Freundinnen Barbara und Heidi. Die Frohnatur aus Fehmarn haben wir in der Zebrabar einige Wochen zuvor im Norden Senegals kennengelernt. Sie lud uns ein, mal bei ihrem Winterwohnsitz an der Petit Cote vorbei zu schauen. Gesagt, getan und so genossen wir ein paar Tage „Urlaubsfeeling“ in der kleinen Wohnsiedlung, wo hauptsächlich französische Pensionäre zur Winterzeit Sonne tanken. Drei Pools und ein kilometerlanger palmengesäumter Sandstrand inklusive.
Jetzt war es aber mal wieder Zeit, unseren Truck auf Expedition zu schicken und so zogen wir an dem besagten Morgen zu dritt los gen Süden. Mit dabei war unser erster Gast, die liebe Marga aus der Pfalz, die die kommenden zwei Wochen bei uns mitreisen werde. Die Route stand fest: Von Saly aus ging es erst einmal Richtung Südwesten, durch das Zentrum des Erdnussanbaus bei Kaolack hindurch bis zum Grenzübergang Farafenni. Von dort aus wollten wir das an dieser Stelle nur 15 Kilometer breite Gambia durchqueren und dann weiter wieder Richtung Küste ans Cap Skirring fahren.
Wir waren gerade mal 30 Kilometer ins Landesinnere abgetaucht, da liefen uns schon die Schweißtropfen die Schläfen hinunter. Das Thermometer zeigte ganze 42 Grad an. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass das lange nicht die Höchsttemperatur bleiben wird. Die Kilometer zogen sich, das Atmen viel schwer und durch die weitgeöffneten Fenster zog ein heißer Föhn statt einem frischen Fahrtwind. Wir fuhren und fuhren und fuhren. Am Abend erreichten wir endlich den Grenzübergang. Unsere Pässe und das Carnet, deutsche Staatsangehörige benötigen kein Visum, wurden sowohl von den senegalesischen Grenzbeamten als auch bei der Einreise nach Gambia ruck zuck gestempelt und ohne auch nur einen Cent zahlen zu müssen ging es 5 Kilometer weiter bis zum Fähranleger. Doch was war das? Eine Schlange aus mehreren hundert LKWs säumte die Piste. Und da sollen wir uns nun anstellen? Das kann ja Jahre dauern, bis wir aufs Schiff kommen. Somit beschlossen wir einstimmig, erst einmal an der Schlange vorbei zu schleichen und uns das Geschehen mal von vorne anzuschauen. Und tatsächlich, wir hatten Glück! Dadurch, dass unser Truck als Campingmobil zugelassen ist, durften wir uns in die Reihe der Autos, die um mehrere Kilometer kürzer war und nicht in die der schweren Laster einreihen. Die nächste Fähre war unsere. Als letztes Fahrzeug durften wir auf die letzte Fähre des Tages fahren. Schwein gehabt! Im Stockedustern, das Fährschiff verfügte über keinerlei Beleuchtung, setzten wir so über den Gambia River über. Auf der anderen Uferseite angekommen, schmissen wir den Motor nur noch für ein paar Minuten an, um in die Kaira Konko Lodge zu gelangen. Wir hätten wohl keinen weiteren Meter heute mehr geschafft.

Zum Abendessen genügte bei der Hitze ein Stück Melone und nach einer erholsamen Dusche fielen wir alle in unsere Betten. An diesem Abend beneidete ich ein wenig unseren lieben Gast um ihren Schlafplatz. Während es nun nachts draußen „nur“ noch 36 Grad hatte, herrschten in unserem Truck immer noch starke 41 Grad. Durch die Maggiolina wehte nun ein leichtes Lüftchen. Wir dagegen fühlten uns wie zwei Sardinen, die gerade samt Büchse in den Ofen geschmissen wurden. Hatten wir uns in Marokko nicht noch nach Wärme gesehnt? Das schien Ewigkeiten her…
Am nächsten Morgen starteten wir mit frischem Elan immer noch mit der Freude darüber, gestern noch die letzte Fähre ergattert zu haben. Heute sollte es wieder ans Meer gehen. Eine leichte Meeresbrise, frische Luft, kühles Nass – das waren unsere einzigen Wünsche am heutigen Tag. So verloren wir keine Zeit und machten uns nach einem vitalisierenden Morgen-Workout und einem großen Obstteller auf zur Grenze. Schon wieder Grenze? Ja, das war echt verrückt, kaum sind wir eingereist hat uns der kleine Staat Gambia auch schon wieder ausgespuckt. Kein Wunder, denn die Ländergrenzen wurden nach dem Maß einer Kanonenflugbahn abgesteckt. Weder nördlich noch südlich vom Gambia River ist das Land je breiter als 45 km.
Alle Grenzformalitäten wurden wie auch schon am Vortag zügig absolviert und so waren wir eine halbe Stunde nach Fahrtantritt auch schon wieder im Senegal. Auf der Nationalstraße 4 ging es weiter Richtung Bignona. Immer wieder mussten wir Schlangenlinien um die Straßensperren aus Autoreifen und Baumstämmen fahren. In einem Ort lagen überall große Felssteine verteilt und kleine Feuer loderten aus dem auf der Straße liegenden Geäst. Ein merkwürdiges Gefühl, zumal in den vergangenen Wochen es wohl erneut Vorfälle gab, bei denen die Separatisten der MFDC Unruhe geschaffen hatten. Ruhig bleiben und nicht anhalten war unsere Devise und so kamen wir auch ohne Unannehmlichkeiten am Damm Richtung Ziguinchor an. Die Stadt begrüßte uns mit einem bestialischen Fischgestank und einer Polizeikontrolle, die zwar alle Ausländer anhält, jedoch nur einen Blick auf den Führerschein werfen möchte.
Jetzt war es nicht mehr weit. Innerlich hörte ich schon das Meeresrauschen. 70 Kilometer trennten uns noch vom Touristenzentrum Cap Skirring, so wie es in den Reiseführern steht. Dort angekommen, ließen wir die Souvenirläden links liegen und holten uns nur ein paar Gurken und Tomaten auf dem hiesigen Markt. Uns kamen zwar ein paar Bleichgesichter, so wie wir, entgegen gestiefelt, aber von einer Tourihochburg würde ich in diesem Fall keineswegs sprechen. Unser „Happyplace“ sollte aber noch ein paar Kilometer weiter liegen. Über die App „iOverlander“ wussten wir von einem Platz, etwas abgelegen, direkt am Strand – also ganz nach unserem Geschmack. Und tatsächlich: Auf halber Strecke zwischen Cap Skirring und Diembéreng liegt die traumhafte Maya Plage. Den Allradantrieb zugeschaltet, gelangten wir über eine Sandpiste nach wenigen Kilometern zu einem wunderschönen feinen Sandstrand. Ein Blick nach rechts: Palmen, Sand und Meer. Ein Blick nach links: Palmen, Sand und Meer. Herrlich!! Es schien, als hätten wir den rund 17 kilometerlangen Beach ganz für uns allein.

Im Schatten von großen Palmen parkten wir ab und richteten uns wohnlich ein. Hier werden wir ein oder zwei Tagen bleiben. Es wurden fünf, weil es einfach so schön war. Das Meer war badewannenwarm, die Küste war gesäumt von Mangroven, Palmen und zahlreichen anderen Sträuchern und Bäumen und tagsüber kamen lediglich ein paar Einheimische auf dem Weg zur Arbeit vorbei. Wir unternahmen Strandwanderungen, werkelten an unserem Truck, schnitten Videos und relaxten. So verging die Zeit wie im Flug, für uns genauso wie für Marga. Ihr Heimflug rückte nun langsam aber sicher immer näher und wir wollten ihr ja nun noch ein bisschen mehr vom schönen Senegal zeigen. Somit entschlossen wir uns schweren Herzens Abschied vom Maya Plage zu nehmen und unsere Weiterreise Richtung Kafountine aufzunehmen.
Zurück ging es nach Ziguinchor, über den Damm nach Bignona und von da aus nun links auf die N5, wieder so eine No-Go-Area-Grenze. Schon von weitem sahen wir dicke Rauchschwaden von unterschiedlichen Stellen gen Himmel ziehen. Ach herrje, was hat das bloß zu bedeuten. Wir überlegten schon Plan B, inwiefern wir unsere Route abändern sollen, gesetzt dem Fall, die Straße wäre unpassierbar, als wir bemerkten, dass die Feuer schlicht und einfach der Holzkohle Herstellung dienten. Da sieht man wieder einmal, wie einem Angst gemacht werden kann.
Nach einem Tag Fahrt kamen wir müde aber völlig ohne jegliche Vorkommnisse in Kafountine, dem Dorf der Rastas und des Reggaes, an. Wir gingen auf die Suche nach einem schönen Schlafplatz am Meer. Nach gefühlten 10 Sackgassen, in die wir bereits eingebogen waren, fanden wir nun endlich eine schmale Piste, die Richtung Strand führen sollte. Auf die Frage hin, ob wir auch mit unserem Truck dort durchkommen würden, reagierten die Dorfbewohner mit wildem Nicken „no problem!“. Einer der Rastas, in diesem Dorf haben wirklich alle Rastas, war sogar so hilfsbereit und begleitete uns zu Fuß. Wer nun denkt, der arme Kerl hätte nebenher joggen müssen, der irrt sich. Wie ein Elefant im Mäuseloch krochen wir im Schneckentempo Richtung Meer. Weil ich das ewige rauf- und runterklettern satt hatte, blieb ich oben auf dem Dach sitzen, um alle drei Meter die Äste weg zu sägen. Es war echt eine Tortur. Nach drei Kilometern, für die wir eine knappe Stunde benötigten, kamen wir mit den letzten Sonnenstrahlen an einer Kreuzung an, von dort aus sowohl der rechte als auch der linke Weg direkt zum Strand führen sollte. Doch weder der eine noch der andere Pfad hätte es zugelassen, dass wir mit unserem Zehntonner dort vor rollen. Also resignierten wir und parkten ab. Alle Mühen umsonst. Verschrammt und verdreckt gönnte ich mir erst einmal eine heiße Dusche. Die kalte hätte ich bevorzugt, doch bei 40 Grad wäre die Hoffnung auf kaltes Wasser illusionär. Macht nichts, denn zum Glück bot unser Kühlschrank noch ein kaltes Bier, bei dem wir den Abend ausklingen ließen.
Am nächsten Morgen schnappte ich mir in der Morgendämmerung meine Laufschuhe und rannte nun zu Fuß zum Wasser. Was ich dort sah, war fast so schön, wie unser Platz in der Südcasamance. Gute acht Kilometer lief ich gen Norden bis zum nächsten Fischerdorf Abéné. An den buntbemalten Fischerbooten machte ich eine Kehrtwende und nahm den Rückweg durch den feinen Sand auf. Der heutige Tag startete somit um Welten besser als der vergangene Tag geendet war und so schöpfte ich auch neue Kraft, um es erneut mit dem Dschungel aufzunehmen. Nach einer halben Stunde, wir hatten ja bereits gestern die meisten Äste beseitigt, war es geschafft und wir fuhren mit der Hoffnung, ein besseres Plätzchen zu finden, nach Abéné.
Am Ortseingang endete die befestigte Straße und so wirbelten wir einmal eine ordentliche Ladung Staub durch das verschlafene Dörfchen. Vorne am Fischerhafen angekommen, bogen wir nach links ab zum Campement Baobab. Eine kleine Piste führte direkt ans Meer vor, doch ob wir da lang kommen würden? Schon wieder waren niedrige Bäume das Problem. Wir parkten erst einmal vorne ab und verschafften uns zu Fuß einen Überblick. Direkt vorne an der Beachbar empfang uns freudig „Mann-O-Mann“, der seine Rasta unter einem knallorangenen Turban trug. Schnell kamen noch zwei, drei weitere Rastafaris herbei, die uns ebenfalls total herzlich begrüßten. Wir fragten, ob wir uns unter die Tannen, direkt neben der Bar hinstellen könnten. „Yes, of course, come, come!“ Hier, nahe der Grenze zu Gambia, sprechen die meisten auch ein wenig Englisch und so war es nun auch einmal für uns kein Problem, sich zu verständigen. Also gut, wir probieren es aus. Unsere Säge ist ja schließlich schon eingearbeitet. Drei dicke Äste und ein kurzes Festfahren im Sand später hatten wir es geschafft. Wir standen im Halbschatten, keine 20 Schritte vom Meer entfernt. Hier kann man sich wohlfühlen.
Beim Erkundungsspaziergang am Strand, trafen wir auf einen weiteren Toubab, wie die Weißen hier genannt werden. Auf die Frage, ob er Englisch spreche, antwortete er in einem urschweizerischem Dialekt „Gruezi, wir können auch Deutsch miteinander sprechen, oder?“. Der Aussteiger mit einem einzigen Dreadlock berichtete uns, dass man hier echt gut „abchillen“ kann und hier jede Nacht mindestens eine Reggea-Party steigt. Wir verabredeten uns gleich für den morgigen Abend und ließen den heutigen mit einem Sundowner am Strand ganz gemütlich zu Ende gehen.

Und so verbrachten wir insgesamt drei Tage in dem wirklich lässigen kleinen Dörfchen, in dem uns die Menschen außerordentlich freundlich und locker gegenüber traten. Nun zog es uns dann jedoch weiter auf unserer Route. Zurück sollte es erst einmal bis Ziguinchor gehen, wo wir ein bisschen Wäsche waschen lassen und unser Visum für Guinea Bissau organisieren wollten. Dieses bekommt man in der Hauptstadt der Casamance nämlich um einiges billiger und vor allem schneller als in Dakar. Ein Visum für einen Monat kostet gerade mal 15000 CFA (ca. 22,50 €) und ist innerhalb von 10 Minuten im Pass drin.
Von jetzt an waren wir wieder zu zweit unterwegs. Marga hatten wir in Abéné in einem schönen kleinen Campement abgesetzt, von wo aus sie in den kommenden Tagen eigenständig nach Banjul, Gambias Hauptstadt, reisen würde, um von dort aus ihren Rückflug anzutreten.
Bevor es in den noch recht ursprünglichen und touristisch weniger erschlossenen Südosten Senegals gehen sollte, quartierten wir uns noch auf dem Campingplatz „Camping Casamance“ direkt neben dem Hotel „Casa“ ein und erledigten alle Dinge, die noch so zu erledigen waren: Wassertank auffüllen, Wäsche waschen, einkaufen, kleine Reparaturarbeiten, klar Schiff machen innen und außen und so dies und das. Da seit einigen Tagen unser Solarsystem nur noch sehr langsam lud, obwohl die Sonne mit voller Wucht schien, suchten wir noch eine Solar-Werkstatt auf. Am Hafen wurden wir fündig. Sofort kam der überaus freundliche Chef von „Sud Solar“ mit zwei Elektrikern in unser Heim gestiegen und überprüfte unsere Batterien. Die seien völlig in Ordnung, doch er erklärte uns, dass bei großer Hitze die Solarmodule weniger Spannung liefern und der Laderegler seinen Betrieb zurück fährt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Außerdem sollen wir unseren Inverter ausschalten, wenn wir ihn nicht brauchen, da dieser ein echter Stromschlucker ist. Sehr gut, wieder was dazu gelernt!
Nach dem nun alle nötigen Dinge erledigt waren, brachten wir unseren Truck wieder auf Temperatur und peilten als heutiges Tagesziel einen Schlafplatz irgendwo in der Pampa hinter Kolda an. Zunächst führte die Straße entlang des Casamance Flusses. Die Landschaft war ausgesprochen schön. Riesig große Palmen ragten gen Himmel und viele grüne Sträucher und Farnen wuchsen rechts und links der Straße. Mit der fortschreitenden Kilometerzahl jedoch entfernten wir uns von der Wasserader und es wurde heißer und trockener. Die Straße glich einer brandneuen Fernstraße, die keine Wünsche offen ließ. Kein Wunder, denn die hatten die Amerikaner erst vor kurzem hier hin gesetzt. Wahrscheinlich soll sie als eine Art Konkurrenz-Projekt zu den Asiaten dienen, die sich von der Meeresseite her versuchen, breit zu machen. Dennoch lag die Durchschnittsgeschwindigkeit nur bei schlappen 50 km/h, denn bei jedem kleinen Ort, davon gab es viele, sehr viele, warteten mindestens drei Bodenwellen auf uns. Was soll’s, wir hatten es ja nicht eilig. Und so tuckerten wir von Dorf zu Dorf bis allmählich die Sonne unterging. Um kurz nach 19:00 Uhr suchten wir uns in der Abenddämmerung ein nettes Plätzchen und wurden auch fündig. Rechts ab ging ein größerer Pfad entlang zwischen Feldern und Bäumen. Es warteten schon zwei Kühe auf uns, die uns neugierig beobachteten, als wir unseren Außentisch aufbauten. Wenn die bloß gewusst hätten, dass dies eine Premiere ohne Gleichen war! Nach ganzen 10.000 km kam zum ersten Mal unser kleiner Außentisch zum Einsatz, den man in zwei Höhen direkt am Truck einhängen kann, um entweder darauf zu kochen oder daran zu essen. Wir wollten zwar weder das eine noch das andere, weil uns die Mücken beim Abendessen vermutlich aufgefressen hätten, aber Alex fand, dass es nun endlich mal Zeit war, das gute Stück auszuprobieren und so ließen wir uns ein kühles Bier schmecken und weihten unseren Hängetisch gebührend ein. Selbstverständlich blieben wir nicht lange unbemerkt, doch außer zwei neugierigen jungen Männern, die einmal „hallo“ sagen wollten, blieben wir den gesamten Abend und die Nacht ungestört.
Am nächsten Morgen zogen wir innerlich ein bisschen unruhig weiter. In der Nacht zuvor hatten wir uns nochmal die Landkarte vorgeknüpft und waren nun unentschlossen, welche Route die beste sei. Als dann der entscheidende Abzweig kam, entschieden wir uns für die längere aber sicherere Variante, bei der wir auf jeden Fall durchkommen werden. Dachten wir zumindest. So fuhren wir über Velingara Richtung Dar Salam, einem Eingang des Niokolo Koba Nationalparks. Dort am späten Nachmittag angekommen, vereinbarten wir einen Trip für morgen mit den Rangern. Mit unserem eigenen Truck sollte es einmal mitten durch den Park gehen, um diesen dann an der Südgrenze zu verlassen. Super, dachten wir, denn so würden wir mehrere 100 Kilometer sparen. Immer noch ein bisschen unsicher, versicherten wir uns auch noch ein fünftes Mal, dass die Strecke durch den Park auch mit unserem riesen Gefährt möglich sei. „No problem, no problem!“ versicherten uns die Ranger und wer würde es nicht besser wissen als die.
Die Nacht verbrachten wir direkt am Gambia River. Am Ortseingang über die Brücke und direkt danach rechts ab. Ein schönes Plätzchen direkt neben dem Fluss. Bei unserem Abend-Workout besuchte uns noch eine Herde Kühe, die zum trinken kam und dann auch ziemlich schnell wieder abhaute. Diese Nacht entschlossen wir uns, oben im Dachzelt zu schlafen, denn zum einen wimmelte es unten im Koffer vor lauter Insekten – kein Wunder, wir standen ja direkt am Fluss – und zum anderen war es oben temperaturmäßig deutlich erträglicher. Mit einem leichten Bauchkribbeln aufgrund der Vorfreude auf den nächsten Tag schliefen wir ein und träumten von Krokodilen, Antilopen, Warzenschweinen und Löwen.
Um 6:00 Uhr klingelte der Wecker. Heute gab es nur ein schnelles Tabata und das Frühstück fiel aus, da der Startschuss schon um 7:00 Uhr fiel. Ausgestattet mit der kompletten Ausrüstung von der Videokamera, über den Fotoapparat und der Actioncam bis hin zur Dashcam und einem Fernglas tauchten wir ein in den Nationalpark. Die ersten 10 Kilometer kamen wir recht gut durch. Wir mussten zwar ein bisschen langsamer fahren und hier und da einem tiefen Ast ausweichen aber bis zum ersten Stopp lief alles glatt. „Rechts ranfahren“ lautete das Kommando unseres Guides, der mehr schlecht als recht Englisch sprach. Wir hielten an einem Aussichtshäuschen direkt am Fluss und waren ganz aus dem Häuschen, als wir bestimmt zehn Krokodile im Wasser zählten. Am Ufer suhlten sich die Warzenschweine im Schlamm und daneben standen Antilopen und verschiedenste Vögel vom Graureiher bis zum größten Vogel Senegals, dessen Name uns leider entfallen ist. Mit offenen Mündern beobachteten wir bestimmt eine halbe Stunde lang, wie drei Krokodile dem gleichen Vogel auflauerten, der wiederum tief damit beschäftigt war, einen Fisch zu verspeisen, der viel zu groß für seinen Schnabel schien. Ein viertes Krokodil kam hinzu und schoss mit einem Mal aus dem Wasser mit einem dicken Hecht im Maul. Kurz darauf war am anderen Ufer ein lautes Gegacker zu hören und das Wasser spritze in die Höhe. Ein anderes Krokodil hatte ebenfalls fette Beute gemacht. Nur schwer konnten wir uns von dem Spektakel losreißen, doch die Zeit drängte ein wenig. Als wir uns gerade umdrehten in Richtung unseres Expeditionsmobils, schoss noch ein Mungo direkt vor unserer Nase vorbei. Das hat sich schon mal richtig gelohnt, dachten wir und stiegen voller Euphorie wieder ein.



Doch unsere Hochstimmung hielt nicht lange an. Der weitere Weg wurde immer schmaler und immer mehr Äste ragten in die Fahrhöhe unseres Trucks. Nun wurde weiteres Equipment ausgepackt: Baumsäge, Astschere, Handschuhe und Axt. Meter für Meter kämpften wir uns vorwärts bis es passierte: Mit einem lauten Scheppern fiel unsere Alubox samt Außenstrahler vom Dach, erfasst und erwürgt von einer Liane. Na super, ich zückte die Kamera und Alex kletterte aufs Dach, um den Schaden zu minimieren. In der brütenden Mittagssonne schraubte Alex die Kabel los und wir luden die Box erst einmal in die Innenkabine. Jetzt sollte es erst einmal weitergehen. Wir wollten uns den Spaß nicht nehmen lassen. Doch das gelang uns nicht ganz, denn kurz darauf deutete unser Führer auf unseren Schanzenspiegel, der in tausend Teile zersprungen war. Na toll, hoffen wir mal, dass der Weg jetzt wieder besser wird, denn sonst stecken wir mit 3 km/h noch morgen hier fest. Die Hoffnung war vergebens. Im Gegenteil, wir tauchten immer weiter ins Gestrüpp ein. Während wir vor Schweiß trieften, Alex war nur damit beschäftigt die Bremse und die Kupplung zu treten, während ich auf dem Dach von rechts nach links sprang, um die Äste abzusägen, fielen unserem Ranger schon die Augen zu. Wir bemerkten erst nach einer Weile, dass er schlief, weil er auch zuvor nahezu keinen Mucks rausbrachte. So langsam kochte die Wut in uns hoch. Ich gebe zu, die Siedetemperatur ist schnell erreicht bei 45 Grad Außentemperatur. Es kam die Frage in uns hoch, warum wir eigentlich diesen teuren Guide buchen mussten, der tatsächlich obligatorisch ist. Die Wege sind alle ausgeschildert und mehr als taubstumm auf dem Beifahrersitz hocken, tut der Kerl sowieso nicht. Zudem hat er noch einen äußerst strengen Geruch in unserer Fahrerkabine verteilt. Genau das richtige für mich.
Der nächste Ast lässt nicht lange auf sich warten und so steige ich durch unsere Dachluke erneut hinauf. Auf einmal meint der Guide doch tätig werden zu müssen, steigt mit seinen Dreckschuhen auf meinen Sitz, reißt mir machomäßig die Säge aus der Hand und fängt an, den Stamm zu beschneiden. Als wenn ich nicht eh schon eingesaut wäre, regnet es nun Raupen, Ameisen, Äste, welke Blätter, Blüten und jede Menge Staub direkt über meinen Kopf in die Fahrerkabine hinein. Ich kann nicht an mich halten, meine Wut kocht über und ich fahre den Kerl mit einem deutschen Wortschwall an. Leider hat er zwar kein Wort von dem verstanden, aber ein bisschen beeindruckt, dass aus einer so kleinen Person so viel rauskommen kann, ist er wohl doch, denn er setzt sich erst einmal auf seinen nun völlig verdreckten Platz und verfällt wieder in sein gut geübtes Schweigen. Zumindest für die kommenden fünf Minuten bis zur nächsten Kreuzung. Hier schießt er nun die Kanone ab. Nach etwa drei Stunden Fahrt eröffnet er uns, dass wir doch nicht die Strecke fahren könnten und nun wieder eine Schleife drehen werden, um an der Nordgrenze des Parks hinauszufahren, also unweit dort, wo wir hergekommen waren. Angeblich hätte er uns das auch schon gestern gesagt nur leider kann weder Alex noch ich mich daran erinnern . . . komisch. Hätten wir das gewusst, wären wir niemals mit unserem monströsen Laster hier rein gerollt, sondern hätten uns entspannt in einen Jeep gesetzt und die Tour genossen. Das wäre uns deutlich billiger gekommen, es wäre um Welten schneller gewesen und vor allem hätten wir uns tatsächlich auf die Tiere konzentrieren können, statt ständig nach rechts und links, oben und unten nach Hindernissen Ausschau halten zu müssen.

Ok, ändern können wir nun eh nichts mehr und so versuchen wir ohne weitere Schäden unseren Truck hier wieder raus zu manövrieren. Insgesamt 11 Stunden nach Fahrtantritt und 80 km später sind wir fast am Ausgang angekommen. Es ist bereits nach 18:00 Uhr und die Parkgrenze ist offiziell schon zu. Die letzten vier Stunden haben wir nahezu stillschweigend im Fahrzeug gesessen. Lediglich „langsam“-, „stop“- und „weiter“-Rufe tönten in regelmäßigen Abständen von mir vom Dach in das Fahrerhaus. Völlig erschöpft stelle ich unserem Ranger die Frage, wie er uns versichern konnte, dass wir mit unserem LKW hier durchkommen würden. Kackfrech antwortet er, dass es möglich sei, denn sonst wären wir nicht hier. Da platzt auch Alex der Kragen und mit voller Wucht steigt er auf die Bremse, um eine Vollbremsung hinzulegen. Zugegeben, die Wirkung lässt bei 3km/h zu wünschen übrig, aber doch scheint unser Super-Führer ein wenig wachgerüttelt. Danach folgt ein Wutausbruch von Alex, wie er so einen Mist labern kann. Unser Truck ist übersät mit Schrammen, Das Fahrerhaus, das Dach und der Gepäckträger sind völlig verdreckt, ein Strahler ist abgerissen, zwei sind komplett verbogen, die Kiste hat es hinunter gefetzt, das Dachzelt ist völlig verkratzt und ein Spiegel ist kaputt! Wie kann er allen Ernstes behaupten, es sei möglich, mit einem 3,80 m hohen Fahrzeug hier durch zu fahren.
Wir sind kurz davor unseren ungewollten Mitfahrer einfach rauszuschmeißen, doch wir wissen noch nicht, wie wir aus dem Park kommen, wenn die Grenze zu ist. Darüber mehrt sich der Typ nämlich auch nicht aus, stattdessen schreibt er nun SMS mit seinem Kumpel.
Und endlich, nach insgesamt 11,5 Stunden Fahrt haben wir den Ausgang erreicht und zu unserer Verwunderung ist dort weder ein Tor noch ein Wachmann. Glück im Unglück. Alex freut sich nun schon sehnsüchtig den erstbesten Platz am Wegesrand zu nehmen, den Truck dort ab zu parken und keinen einzigen Meter mehr für heute zu fahren. Doch unser Guide macht uns erneut einen Strich durch die Rechnung und sagt, wir sollen ihn noch bis zum nächsten Ort fahren, weil er sonst nicht nach Hause käme. Auf die Frage, wie weit der weg sei, antwortet er „30 Kilometer“. Wir verdrehen die Augen, sehen aber ein, dass wir den Kerl nicht hier mitten im Nirgendwo einfach absetzen können und da die Straße gut ist, wir mit 85 km/h Speed geben können, entscheiden wir uns, noch bis Niokolo zu fahren.
Doch das Fahrvergnügen ist nur von kurzer Dauer. Nach 10 Kilometern ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt und es beginnt eine hügelige Wellblechpiste, die sich rechts und links von der eigentlichen Spur entlang schlängelt. Es ist mittlerweile schon dunkel und uns kommen riesige LKWs mit schwerer Ladung entgegen. Diese verfügen nur in den seltensten Fällen über Licht und sind chronisch überladen. Immer wieder passieren wir umgekippte LKW-Leichen und der Staub verschlechtert die Sicht in solch einer Weise, dass wir auch schon Angst haben, bald dort im Graben zu liegen. Fast wie in Trance schieben wir uns Stück für Stück an den LKW-Riesen und dicht am Abhang voran. Irgendwann entdecken wir in der Ferne ein Licht und unser Guide macht eine Geste, dass wir dort von der Piste abfahren sollen. Der Ort Niokolo entpuppt sich als Ranger-Stützpunkt. Wir treffen gleich auf drei Franzosen, die dort Dienst eines gemeinnützigen Projekts leisten. Freundlicherweise macht uns einer der drei mit dem Chef-Ranger bekannt, der uns direkt erlaubt, auf dem Gelände die Nacht zu verbringen. Völlig geschlaucht und mit den Nerven am Ende wollen wir einfach nur noch duschen, essen und schlafen. Unsere Mägen knurren beachtlich, denn nachdem wir das Frühstück haben ausfallen lassen, wurde uns auch noch das Mittagessen untersagt, weil wir dafür keine Zeit mehr hätten. Alex und ich steigen aus, bauen die Leiter auf, die Außendusche und beseitigen noch den gröbsten Dreck, als auf einmal unser Führer von der Seite ankommt und Kohle für seine Rückfahrt haben will. Alex will gerade dazu ansetzen, ihm eine Verbal-Wolke aus Ärger, Enttäuschung und Erschöpfung entgegen zu schießen, da schnappt er seinen Rucksack, macht auf dem Absatz kehrt und dreht ab. Sein Glück.
Bis auf einen nächtlichen Zwischenfall verläuft die Nacht ruhig. Um etwa 4:00 Uhr morgens werden wir wachgerüttelt von einem wahren Affentheater. Da wir eigentlich noch mitten im Nationalparkgelände stehen, die Nationalstraße führt einmal quer hindurch, wimmelt es nur so von Affen um uns rum. Irgendwie scheinen sie am frühen Morgen entweder eine wilde Party zu feiern, oder einen todernsten Krieg zu führen. Jedenfalls schreien sie aus allen Ecken was das Zeug hält, sodass an einen ruhigen Schlaf kaum mehr zu denken ist. Glücklicherweise beschließt die Affenbande eine halbe Stunde später das Kriegsbeil zu begraben oder vielleicht sind auch nur die Drinks für die Party ausgegangen. Jedenfalls ist nun wieder Ruhe und wir können noch zwei Stündchen weiter schlummern.


Dann geht’s aber aus den Federn, Frühsport ist angesagt und danach folgt eine Lagebesprechung. Was machen wir nun; fahren wir weiter auf dieser hundsmiserablen Piste, oder drehen wir tatsächlich um und fahren aus nördlicher Richtung über die Grenze nach Guinea. Nun sind wir das erste Mal an dem Punkt, dass wir nicht wissen, ob wir den Weg, den wir fahren wollen, auch tatsächlich passieren können. Dschungelerprobt sind wir jetzt zwar, aber eigentlich wollen wir unser Expeditionsmobil und uns nicht nochmal so einer Tortur unterziehen. Wir haben zuvor oft über eine solche Situation gesprochen, dass es sein kann, dass wir hunderte von Kilometern fahren werden und am Ende doch umdrehen müssen, weil wir nicht weiterkommen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Piste aber wirklich schrecklich ist und wir nicht wissen, wie der weitere Weg ist, sind wir uns wirklich unsicher. Wir holen uns erst einmal Rat bei den ansässigen Rangern und erkunden uns, ob sie meinen, dass wir auf der geplanten Route über die Grenze nach Guinea kommen. Nach ihrer Zustimmung beschließen wir, es zu wagen und so langsam steigt euch ein freudiges Bauchkribbeln in mir hoch, zum ersten Mal verspüre ich echtes Expeditionsfeeling.
Los geht’s, wir rollen wieder auf die rote, staubige Piste und kämpfen uns 40 km, für die wir 4 Stunden benötigen, über Wellblech, tiefe Löcher, vorbei an LKW-Fracks, durch riesen Staubwolken hindurch immer in Richtung Kedougou, Senegals letzte große Stadt vor den Grenzen zu Mali und Guinea. Es ist kaum zu fassen, obwohl die Straße eh schon verdammt schwierig zu befahren ist, ist irgendein irrwitziger doch tatsächlich auf die Idee gekommen, noch ein paar Bodenwellen einzubauen. Da hat es jemand wohl gar nicht gut mit uns gemeint, denken wir, als wir auf einmal von etwas besserem belehrt werden. Wir können unseren Augen nicht trauen: vor uns beginnt eine gut ausgebaute Teerstraße. Wir trauen uns noch gar nicht so richtig, uns zu freuen und erwarten hinter jeder Kurve wieder die rote Piste. Nur langsam bringe ich unseren Truck wieder auf eine angemessene Reisegeschwindigkeit doch nach ein paar Kilometern haben wir das Vertrauen in die örtlichen Straßenbauer gefunden und geben wieder Gas.
Am Nachmittag erreichen wir Kedougou und steuern ein Campement an, wo es angeblich einen Pool gibt. Nach dem ganzen Dreck der letzten Tage, wollen wir uns einfach diesen kleinen Luxus gönnen. Wir werden fündig und stellen unseren Truck auf dem Parkplatz des Hotels „Relais de Kedougou“ ab. 2000 CFA, umgerechnet 3 €, soll die Nacht für uns in unserem Expeditionsmobil kosten. Dusche und Toilette gibt es keine, aber wir dürfen den Pool benutzen und an der Bar gibt es kalte Getränke. Wir schlagen ein, schlüpfen in die Badeklamotten, springen in den Pool und verwöhnen uns im Anschluss mit einem kalten Drink auf der Terrasse direkt über dem Gambia River. Die Strapazen der letzten Tage sind vergessen und so blicken wir mit Eifer auf die nächsten Tage.
Am kommenden Morgen wollen wir bezahlen und auf einmal heißt es 10000 CFA statt 2000 CFA. Man kann es ja mal versuchen. Wir verhandeln etwas, tanken noch ein bisschen Wasser und fahren dann los. Zu unserer Beruhigung hatte auch der Hotelmanager uns versichert, dass wir auf der geplanten Route durchkommen werden. Auf einer guten Piste geht es Richtung Salemáta. Nach 9 Kilometern geht es links ab nach Dindífelo – da wollen wir hin! Zwei Stunden tuckern wir durch schöne Landschaft auf einer passablen Piste. Wir werden zwar ganz schön durchgeschaukelt, aber es ist nahezu kein Verkehr und die Aussicht auf ein kühles Bad unter dem Wasserfall treibt uns voran. In dem kleinen Dorf nahe der guineischen Grenze stürzt aus 80 Metern Höhe Wasser in die Tiefe. Genau der richtige Ort, wo man sich bei mittlerweile 48 Grad aufhalten sollte.
In Dindífelo angekommen, parken wir unser Expeditionsmobil ab, schnacken kurz mit den Jungs am Ticketshop und zahlen den Eintritt in Höhe von 1000 CFA pro Person. Durch dschungelähnlichen Wald geht es eine knappe halbe Stunde hinauf. Immer wieder plätschert ein kleiner Bach neben dem Pfad und es ist angenehm schattig. Fast oben angekommen, kommt uns eine deutsche Reisegruppe entgegen. Es ist schon lange her, dass wir Landsleute getroffen haben und so kommen wir kurz ins plaudern. Sie versichern uns, dass es nicht mehr weit ist und tatsächlich erreichen wir nach weiteren 5 Minuten den Wasserfall. Nichts kann uns mehr halten. Schnell die Badesachen angezogen, springen wir ins kühle Nass. Und in diesem Fall ist es tatsächlich kühl um nicht zu sagen verdammt kalt. Herrlich!! Nach einer kurzen Erfrischung treibt es mich wieder raus und ich suche mir ein schönes Plätzchen auf den umliegenden Felsen. Alex hält es noch ein wenig länger aus, um ein paar Filmaufnahmen zu machen. Doch nach ein paar Minuten gesellt er sich mit blauen Lippen und Gänsehaut zu mir. „Das ist das erste Mal seit Tagen, dass ich mal wieder friere“, berichtet er mir schmunzelnd. In einer Felsspalte gegenüber ist gerade eine fette Würgeschlange dabei, einen Alligator zu verspeisen. Dann muss ich wohl auch nochmal ins Wasser und mir das Schauspiel ansehen. Wirklich! Ich frage mich nur, wo eine solch große Schlange herkommt und vor allem, was dieses Krokodil hier macht. Hier hat es der Mensch doch tatsächlich noch nicht geschafft, alles zu verdrängen, was kriecht und krabbelt. Zum Glück!

Diese Vermutung bestätigt sich auch am kommenden Tag. Die Nacht haben wir im Campement direkt am Eingang zu den Wasserfällen verbracht. Strom und Wasser gab es nicht, dafür aber einen ruhigen Stellplatz. Vormittags waren wir damit beschäftigt, unser Filmmaterial der letzten Tage zu ordnen und am Nachmittag machten wir uns dann nochmals auf den Weg zum piscine nature. Nur ein paar Meter vor dem Wasserfall standen ein paar Menschen mit in den Nacken geneigten Köpfen. Wir folgten ihren Blicken und zu unserer wahnsinnigen Freude hockten keine 20 Meter von uns entfernt fünf wilde Schimpansen im Baum. Geil!! Ohne einen Mucks zu machen, beobachteten wir die Menschenaffen eine ganze Weile, bis sie sich dann vom Acker machten und wir erneut die Abkühlung suchten. Als würden wir für die nächsten Tage noch ein bisschen Kälte tanken wollen, blieben wir den ganzen Nachmittag bis zur Dämmerung am Wasser.

Neuer Tag, neues Ziel: Salemáta sollte das Ende unserer heutigen Tagesetappe sein. Hindurch ging es durch viele kleine Dörfer der Bassari, einem Urvolk Senegals und die älteste Bevölkerungsgruppe dieser Region- Aus Lateritblöcken formen sie kleine runde Häuser mit Schilfdächern. Uns erinnert der Anblick an kleine Hobbithäuser nur etwas exotischer. Nach 75 Kilometern und rund 5 Stunden Fahrt erreichen wir die Siedlung und machen uns auf die Suche, nach einem Campement, bei dem wir Strom tanken können. Beim dritten Campement werden wir fündig. Ein Glück, denn unsere Stromanzeige ist bedenklich gesunken. Auf dem schönen kleinen Anwesen finden wir ein gutes Plätzchen für unser mobiles Zuhause. Lediglich die Einfahrt durchs Tor hat nochmal unsere volle Aufmerksamkeit verlangt. Rechts und links waren zusammen nur noch 5 cm Platz, ungelogen! An den Strom angedockt, konnten wir so den Abend bei einem leckeren Nudelsalat mit viel Grün und reifen Gartentomaten genießen.
Der nächste Morgen begann trüb. Die Sonne war nicht zu sehen. Der Harmattan, der Wind aus der Sahara, hatte winzig kleine Sandkörner in der Luft verteilt. Was so aussah wie dichter Nebel, war in Wahrheit Staub. Zum Glück hatten wir nun wieder volle Batterien, denn bei diesen Bedingungen wären wir sonst sofort abgeschmiert. Zum Fahren war es jedoch ganz angenehm, da die Sonne so uns nicht so ganz rücksichtslos brutzeln konnte.
Am gestrigen Abend sagte ich vor dem Einschlafen noch zu Alex, dass heute wohl ein spannender Tag werden wird. Diese Prophezeiung sollte sich bewahrheiten. In meinem Kopf tönte immer der Satz vom Campement-Besitzer, dass wir einen kleinen Fluss zu überqueren haben. Knietief sei das Wasser, glaubt er, aber er war auch schon länger nicht mehr dort. Die Tiefe ist nicht so wild, dachte ich mir, nur der Untergrund sollte nicht morastig sein, sonst stehen wir mit unseren 10 Tonnen im Nassen fest. Egal, positiv denken! Die Piste war keine Rennstrecke aber gut befahrbar. Auf dem Weg nach Oubadji, dem senegalesischen Grenzposten, galt es erst ein kleines und dann ein großes Hindernis zu überwinden. Das erste war ein völlig ausgewaschener Hang mit einer beachtlichen Steigung, der sich beeindruckend vor uns aufbaute. Aber alles halb so wild, im ersten Gang schlich unsere Kiste wie ein Wiesele den Hügel hinauf. Doch dann kam der besagte Fluss. Nicht lang gefackelt, zog ich meine Schuhe aus und watete hindurch. Der Boden bekam die Note befriedigend und auch die Tiefe war machbar. Jedoch mussten wir, um ans Wasser zu kommen, erst einmal einen steilen, unebenen Abhang hinunter, der mit Lianen zugewachsen war. Nach dem Bach folgte aber die eigentliche Herausforderung. Eine extrem schmale Fahrrinne mit 3 Meter hohen Wänden rechts und links und sandigem Untergrund führte etwa 20 Meter das Tal wieder hinauf. Geschätzte Breite: 2,55 Meter, das entspricht genau den Maßen unseres Trucks. Alex setzte sich ans Steuer, während ich versuchte, die Lianen aus dem Weg zu räumen. Um uns rum sprangen etwa 20 Kinder der drei kleinen Nachbardörfer und feuerten uns lautstark an. Die großen Jungs eilten mir gleich zur Hilfe und rissen mit vollem Körpereinsatz die Schlingpflanzen ab, sodass Alex freie Fahrt hatte. Der Abhang war fast geschafft, Alex löste den Fuß von der Bremse, um noch ein bisschen Schwung zu gewinnen und dann ging‘s rein in den Fluss. Bislang alles easy-pisi. Ich stand am anderen Ufer und nahm das Spektakel mit der Kamera auf, doch ich wusste ja, dass die größte Schwierigkeit noch bevorsteht. Und ich hatte tatsächlich richtig geschätzt! Zwischen unserem Truck und den Felswänden hätte keine Hand mehr zwischengepasst. Die Räder schrappten schon an den Seitenwänden und das linke Paar drohte den Bodenkontakt zu verlieren, da der Weg so uneben war. Ich hielt die Luft an und versuchte die Kamera ruhig zu halten. Auf einmal war es mucksmäuschenstill. Auch die Kids schienen voller Spannung. Das einzige Geräusch kam von unserem brummenden LKW. Mit Mühe kämpften Alex und er sich den Hügel hinauf. Noch 3 Meter, 2, 1, geschafft! Und sofort ging wieder das Gejubel los. Alle Kinder sprangen hinter her und ich war mittendrin. „Cadeau, cadeau!“, riefen sie und ich fand, diese Rasselbande hatte sich wirklich etwas verdient. So sprang ich in den Truck und holte zwei große Haribo-Tüten, die in Nullkommanichts geleert waren. Die Kinder waren glücklich, wir auch und so ging es erleichtert weiter.
An der kleinen Grenze in Oubadji stempelte der einzige Grenzbeamte unseren Pass und unser Carnet. Letzteres stempelte er zunächst falsch, verbesserte dann aber schnell sein Missgeschick. „Toujours droit devant“ wies uns der Grenzer an, wir folgten seinem Hinweis und fuhren immer geradeaus. Doch schnell wurde uns klar, dass es ab jetzt nicht mehr so flüssig weitergehen wird. Die Landschaft und vor allem die Piste ähnelten sehr denen aus dem Nationalpark und weckten böse Erinnerungen. Somit wechselte ich meinen Sitzplatz, schnappte mir Säge und Handschuhe und kletterte aufs Dach. Die Kommunikation der folgenden zwei Stunden bestand aus den bereits bekannten Anweisungen „langsam“, „stopp“, „weiter“ plus dem Hinweis von Alex „festhalten“. Und so schlichen wir uns Meter für Meter, Ast für Ast durch den dichten Wald hindurch. Zwar kamen wir noch langsamer voran als im Niokolo Koba, da der Weg noch unebener und noch zugewachsener war, aber dafür hatten wir im Hinterkopf, dass wir unserem Ziel immer näher kommen: die Grenze zu Guinea.
„Da rechts eine Hütte!“ „Und links noch zwei.“ „Da hinten ist ein ganzes Dorf und der Weg wird breiter!“. Land in Sicht oder besser gesagt, Land in freier Sicht. Wir hatten es geschafft. Ob da wohl jemals schon ein anderes Expeditionsmobil sich durchgeschlagen hat? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht – jedenfalls waren wir doch ein bisschen stolz, dass wir es durchgezogen haben. Die Uhr zeigte schon 19:30 Uhr, die Grenze ist bestimmt schon geschlossen und so parkten wir ab am Wegesrand unter großen, schönen Mangobäumen.
Am nächsten Tag kam bereits nach wenigen Kilometern das Grenzörtchen. Schon am Dorfeingang nahm uns ein Bewohner in Empfang und führte uns zur Polizeidienststelle. Die guckten auch nicht schlecht, als sie unseren Truck sahen und ihnen klar wurde, welche Strecke wir mit ihm gefahren sind. Noch verwunderter guckten sie aber, als wir ihnen unsere Pässe mit den Visa, die wir bereits in Dakar geholt hatten, zeigten. So etwas hatten sie zuvor wohl noch nicht gesehen und wussten auch nicht viel damit anzufangen. Völlig verdattert vergaßen sie so, uns einen Einreisestempel zu geben. Für den Stempel unseres Carnets wollten sie dann jedoch auf einmal Kohle kassieren. Wir stellten uns erst ein bisschen doof, als wenn wir nichts verstehen würden. Daraufhin riefen sie einen Kollegen, der angeblich Englisch konnte, an, der aber natürlich auch kein Wort angelsächsisch sprach. Nach einer halben Stunde Diskussion hatten wir ihnen verklickert, dass sie von uns keine müde Mark erhalten werden und so schickte uns der Ober-Polizei-Gockel mit einer abfälligen Geste aus seinem Office.
Das konnte unsere Freude jedoch nicht trügen. Wir waren einfach froh, endlich in Guinea zu sein!